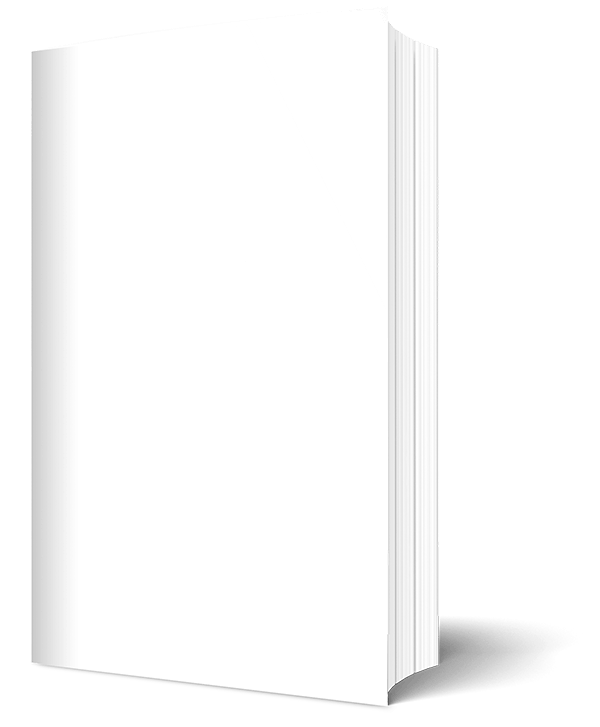"Ein Kind namens Hoffnung" und ein ausführliches Interview mit Marie Sand bei mein-literaturkreis.de.
Wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt
Elly Berger wird 1900 in eine Pfarrerfamilie geboren. Wenn es nach ihrem Vater gegangen wäre, hätte sie studieren sollen, doch Elly hat nur einen großen Traum: Sie will Köchin werden. Es gelingt ihr, in Berlin eine Stellung bei der jüdischen Familie Sternberg zu finden, die ihr fortan ein Zuhause bietet. Vor allem dem kleinen Sohn Leon schenkt sie ihre ganze Liebe. Doch dann wird die Familie bei den Nazis denunziert und die Eltern verhaftet. Für Elly zählt nur noch eines: Sie muss Leon retten! Sie flieht mit dem Jungen, gibt ihn als ihr eigenes Kind aus und ist von diesem Augenblick an für
lange Zeit heimatlos.
Eine heimliche Heldin verlässt sich auf die Stimme ihres Herzens. Sie zögert nicht, sie handelt, und dafür will sie keinen Applaus. In ihrer leisen Art bewegt eine heimliche Heldin Großartiges, so wie die deutsche Köchin Elly Berger, als sie das jüdische Kind vor den Nazis rettete und fortan für eine lange Zeit heimatlos blieb.
Marie Sand über »Ein Kind namens Hoffnung«

Leseprobe
Ein Kind namens Hoffnung
PROLOG
MÜNCHEN, AUGUST 1957
Reihenweise zählte sie Männer in Grau. Elly mochte die Farbe nicht, auch nicht in diesem Festsaal. Sie drückte sich in den Plastikstuhl und atmete schwer. Man sollte mal die Fenster öffnen und die Sonne reinlassen, dachte sie und vermisste ihre gemütliche Eckbank zu Hause. Normalerweise saß sie um diese Zeit in Kittel und Wollsocken in der Küche, einen dampfenden Hagebuttentee auf dem Tisch und dazu einen Keks. Aber heute wollte sie vornehm sein. Den kleinen Hut trug sie schräg auf dem Kopf, und für das blaue Kostüm hatte sie ein Vermögen ausgegeben. Nun schwitzte sie unter den Armen, und die Nylonstrümpfe rutschten. Elly beugte sich nach vorne, um die Falten wieder glatt zu ziehen, dabei stieß sie gegen die Schulter eines Mannes vor ihr. Missmutig drehte er sich um. Sie nickte verträglich und lehnte sich wieder zurück. Immerhin war sie Gast. Eine unter fünfhundert, um dem Redner zu lauschen.
Er sprach zu leise. Seit dem Luftangriff 1944 war Elly das Gehör zum Teil abhandengekommen. Geplatztes Trommelfell, schlecht verheilt, vermutlich vernarbt mit den Jahren. Dummerweise hatte sie das Hörgerät vergessen; es lag auf dem Nachttisch in diesem feinen Hotel rechts der Isar. Elly kniff die Augen zusammen, als könnte sie dadurch besser verstehen, was der Mann auf der Bühne erzählte. Irgendetwas von Erfolg, von Siemens’ Aufbruch in Argentinien, vom Zusammenrücken Deutschlands mit dem Ende der Welt. Er lachte über seine eigenen Worte, bevor er die Arme wie ein Sieger zur Decke hob und fortfuhr: »Nicht nur der Tango beschreibt das Lebensgefühl dort. Nein, es ist auch der Stolz auf eine ganze Epoche. Siemens hat sie mit seiner Nachrichtentechnik geprägt.« Der Redner klopfte sich gegen seine Brust und rief laut in den Saal: »Viva Argentina!«
Elly stupste ihre Tochter an. »Ich mag keine Jubelrufe.« Statt zu antworten, hob Mathilda den Zeigefinger an ihre gekräuselten Lippen.
»Ist doch wahr«, bekräftigte Elly, und da kam Beifall auf, erst zaghaft in der vorderen Reihe, dann wogte er durch den Saal. In ihn hinein verneigte sich der Redner wie ein UFA-Star.
Elly klatschte nicht, sondern fingerte nach ihrem umhäkelten Taschentuch. Sie schnäuzte kräftig. Mathilda drehte sich verlegen zur Seite, und Elly dachte, dass es gut sei, hier neben ihr zu sitzen. Zum Anbeißen schön sah sie in diesem gelben Seidenkleid aus. Ja, Helligkeit brauchte die Welt, bunte Muster – ohne Grau.
»Noch was im Programm?«, fragte Elly.
»Ein Klavierstück.«
»Welches?«
»Du kennst dich doch nicht aus. Hier steht: Klaviersonate in h-Moll von Franz Liszt.«
»Wer spielt es?«
»Keine Ahnung«, antwortete Mathilda und drehte das mit einer Kordel versehene Büttenpapier um. »Mehr schreiben die nicht. Da steht kein Name.«
»Das wurde vor hundert Jahren in Berlin uraufgeführt. Dafür baute der alte Bechstein einen unzerbrechbaren Flügel. Auf dem konnte Liszt stampfen, während er spielte. Ja, das hat er getan. Auf das Gehäuse ist er gestiegen, hat die Gefühle rausgelassen, als hätte er Fieber. Da fielen die Frauen sogar in Ohnmacht! Wie heute bei Elvis.«
»Mama, woher weißt du das denn?«
»Niemals kann das eine von Siemens spielen.«
Dann wurde es dunkel im Saal. Nur ein Spot auf der Bühne, der Bechstein-Flügel stand im Lichtkegel. Was für eine Eleganz unter dem Lack, fand Elly. Sie vernahm die hohl anmutenden Oktaven. Töne, die durch die Hitze im Saal aufstiegen und grollten wie ein Donnerschlag. Die aufbarsten, zu Wasserperlen wurden, spritzig, plätschernd, leiser wurden – und zur Stille mahnten. Halb war die Pianistin aufgesprungen, ein Tanz im Spiel, mitten hinein in die Fontäne aus Tönen, hatte mit dem ganzen Körper Akzente gesetzt, um im Ausklang die Tasten zärtlich zu streicheln. Und Elly atmete nicht, legte beide Hände auf ihr rasendes Herz. Solch eine Kunst in diesem Saal?
Da fiel ein Sonnenstrahl durch den Spalt der Vorhänge, hin zur Frau auf der Bühne, die mit durchgestrecktem Rücken auf dem Hocker saß. Das Kinn gehoben, die Haare im Nacken zusammengesteckt. Sie hielt die Hände in der Luft, berührte mit dem Daumen die Fingerspitzen, als wollte sie Staubkörner fühlen.
Elly schloss die Augen. Öffnete sie wieder. Die Frau auf der Bühne war keine Erscheinung. Die Frau auf der Bühne war aus Fleisch und Blut, war lebendig. Und Elly bildete sich ein, den schweren Duft von Maiglöckchen zu riechen.
Als die Sonate noch in der Luft hing, stand die Frau auf und schritt zum Bühnenrand. Dort verweilte sie, zwei Sekunden, drei Sekunden, mit selbstbewusstem Lächeln und gefalteten Händen.
Auch wenn Ellys Gehör Schaden erlitten hatte, so waren ihre Augen wie die eines Adlers: Fünfzehn Meter entfernt von ihrem Plastikstuhl stand sie. Auf der Bühne. In Schönheit gealtert. Neunzehn Jahre hatte das Schicksal gerafft.
Hatte Elly seit damals das Betteln um Glück vermieden, hatte sie sich nicht auf den Himmel verlassen, sondern auf ihre eigene Kraft – jetzt hob sie die Augen: Danke. Danke, Gott, für dieses Wunder.
Dann schlug sie hart auf den Boden. In der Ferne hörte sie das Raunen. Und ihr letzter Gedanke war: Nun habe ich ihr den Applaus geklaut